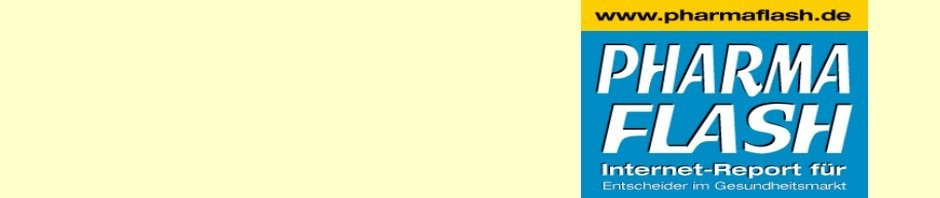In der Vorinstanz war eigentlich schon alles klar (PharmaFlash berichtete im April dieses Jahres, hier):
(Tenor:) Der normale Nutzer erkennt nicht, dass der oberste Eintrag in der Ärzteliste ggf. gekauft ist. Das Oberlandesgericht sah das in der Berufung wohl genauso, so dass jameda kurz vor Schluss das Rechtsmittel zurückzog und die Entscheidung damit faktisch akzeptierte (Meldung hier). Die mehrheitliche Burda-Tochter (über Tomorrow-Focus) jameda nimmt Stellung:

»Es war nie die Absicht … darüber hinwegzutäuschen, dass es sich bei der „Top-Platzierung“ um einen kostenpflichtigen Eintrag handelt.« Ein Blick auf die Homepage